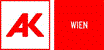1. Über Tuch und Wein: Unterbelichtete Aspekte eines klassischen Exempels
Der Nutzen des Außenhandels resultiert prinzipiell neben der Erweiterung des heimischen Güterangebots aus den Produktivitätssteigerungen infolge der globalen Arbeitsteilung. Zur Demonstration der potenziellen Spezialisierungsgewinne dient regelmäßig das Theorem der komparativen Kostenvorteile von David Ricardo (1817/1990, 131ff).1) In seinem Furore machenden Beispiel kann Portugal im Vergleich zu England die beiden Waren Tuch und Wein pro jeweiliger Maßeinheit mit weniger Arbeitseinsatz herstellen. Trotzdem lohne es sich für alle Beteiligten, dass die Menschen in England den Gesamtbedarf an Stoff weben und jene auf der Iberischen Halbinsel den in beiden Ländern getrunkenen Rebensaft keltern. Diese Auffassung verbreiten die Bestseller der ökonomischen Lehrbuchliteratur seit längerem vorbehaltlos als frohe Botschaft, die unterdessen auch im politischen Raum zum Standardrepertoire gehört.2)